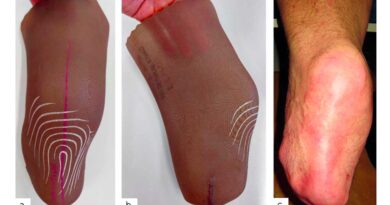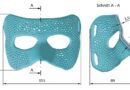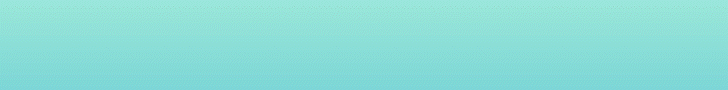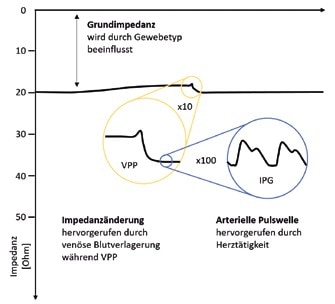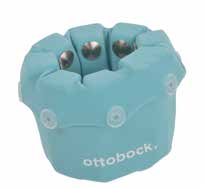Konservative Versorgung als relevante Option
Prof. Dr. Romain Seil (Luxemburg) und Dr. Rolf Michael Krifter (Graz) ließen gleich zu Beginn des jährlichen Zusammentreffens der Gesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (GOTS) aufhorchen, als sie zur Eröffnung fragten: „Braucht es überhaupt noch einen Kongress?“
Weiterlesen