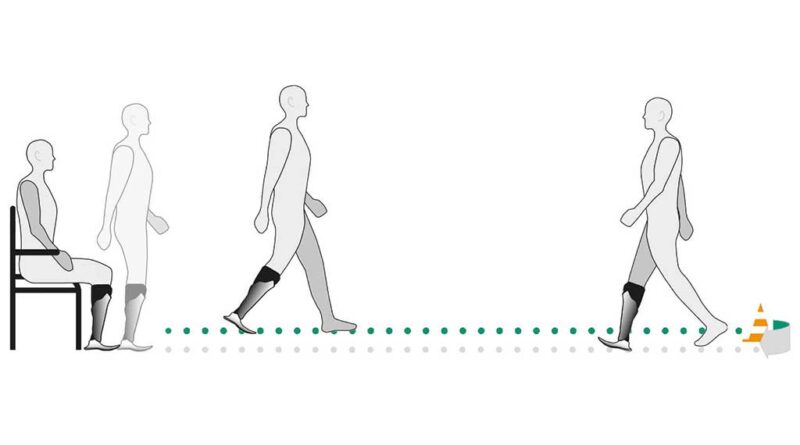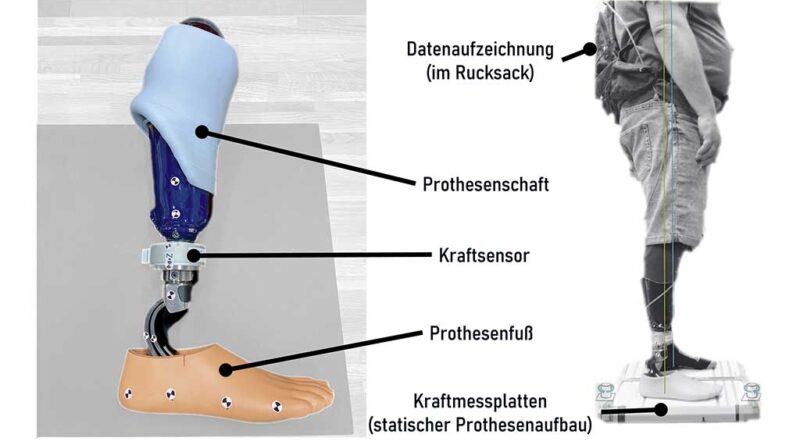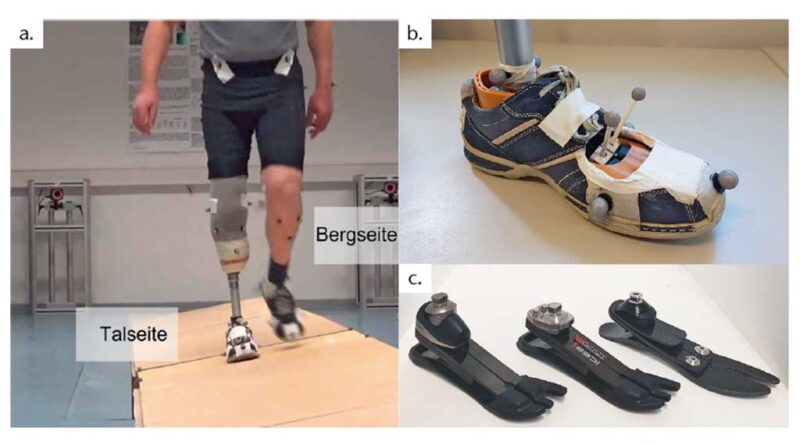Teilhandamputation: Vergleich der Versorgungsmöglichkeiten
R. Münch
Im Jahr 2020 wurden laut Statistischem Bundesamt 5.449 Amputationen im Bereich der Hand in Deutschland durchgeführt [Quelle: Statistisches Bundesamt. Gesundheit. Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik). Operationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (4‑Steller). https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Krankenhaeuser/
Publikationen/Downloads-Krankenhaeuser/operationen-prozeduren-
5231401207014.pdf?__blob=publicationFile. [Wiesbaden:] Destatis, 2020 (Zugriff am 10.11.2022)]. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Amputationen einzelner Finger bzw. Teilfinger. Die prothetische Versorgung nach Amputationen im Finger- und Handbereich wird häufig auf eine ausschließlich kosmetische Funktion reduziert. Selbst heute noch erscheinen auf ärztlichen Verordnungen begrifflich fragwürdige Bezeichnungen wie „Schmuckfinger“ oder „Schmuckhand“. Dabei hat der Ersatz einer amputierten Gliedmaße definitiv nichts mit dem Schmücken des Körpers zu tun [Quelle: Schäfer M, Dreher D, Muders F, Kunz S. Prothetische Versorgung nach Amputationen im Finger- und Handbereich – Stand der Technik nach dem „Qualitätsstandard im Bereich Prothetik der oberen Extremität“. Orthopädie Technik, 2014; 65 (8): 22–30]. Durch den steten Fortschritt der Technik gibt es mittlerweile mehrere Möglichkeiten, auch solche Amputationsniveaus mit aktiven Prothesen zu versorgen.