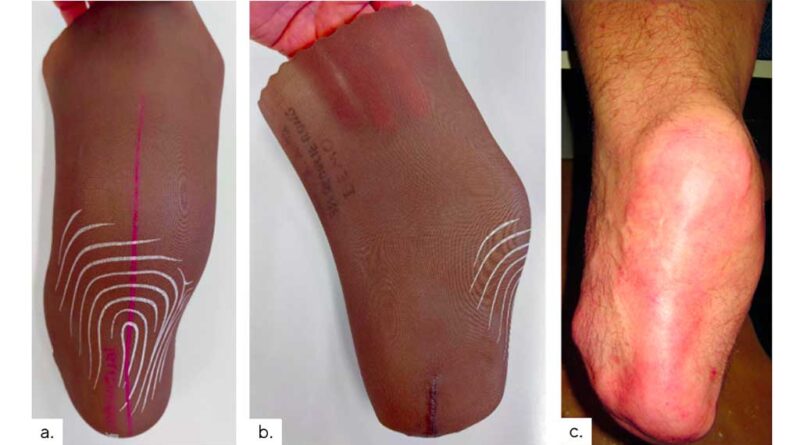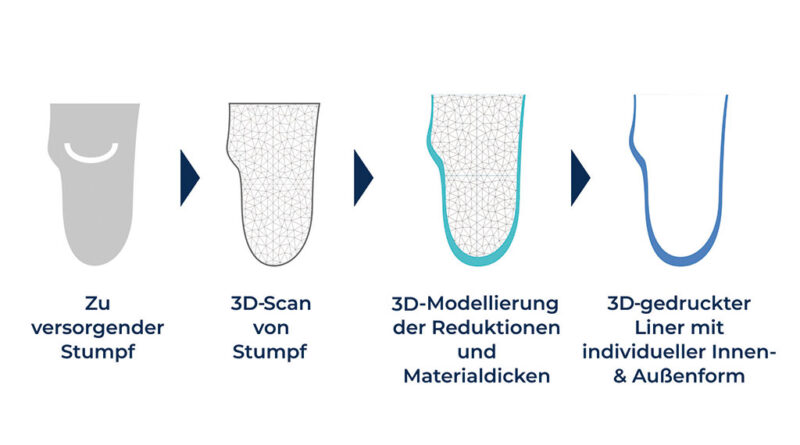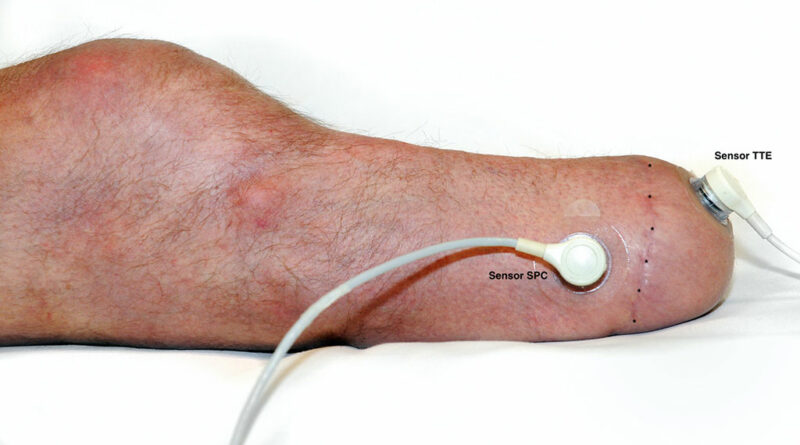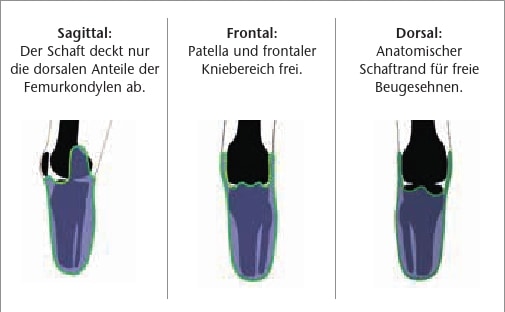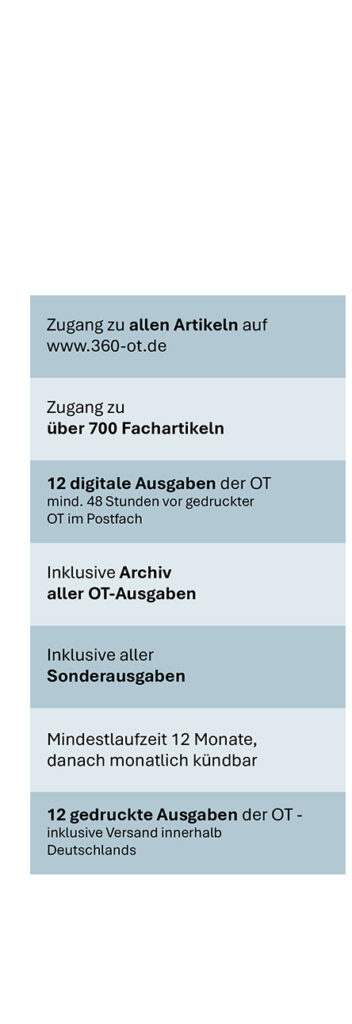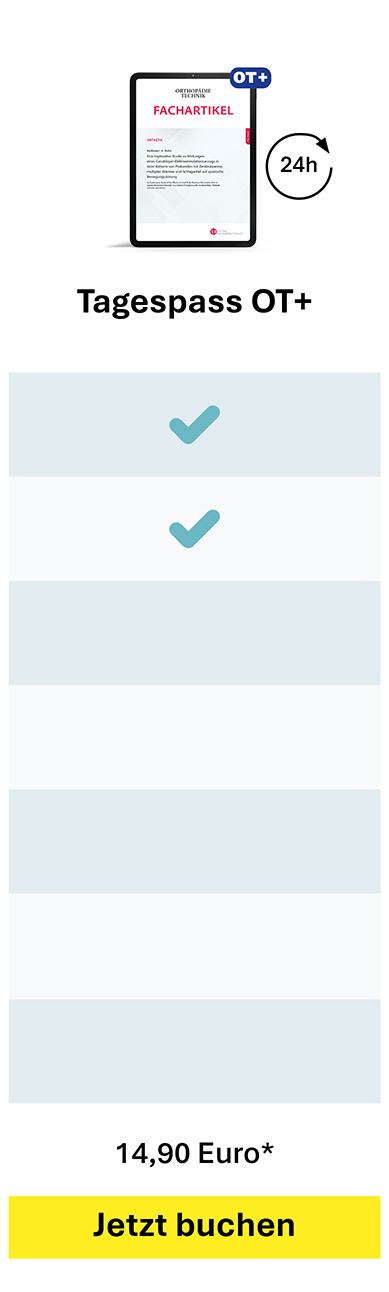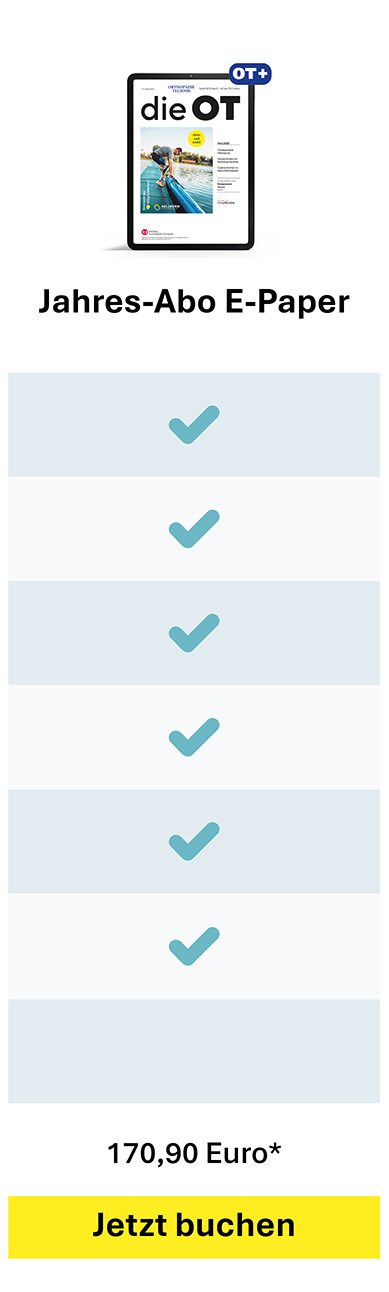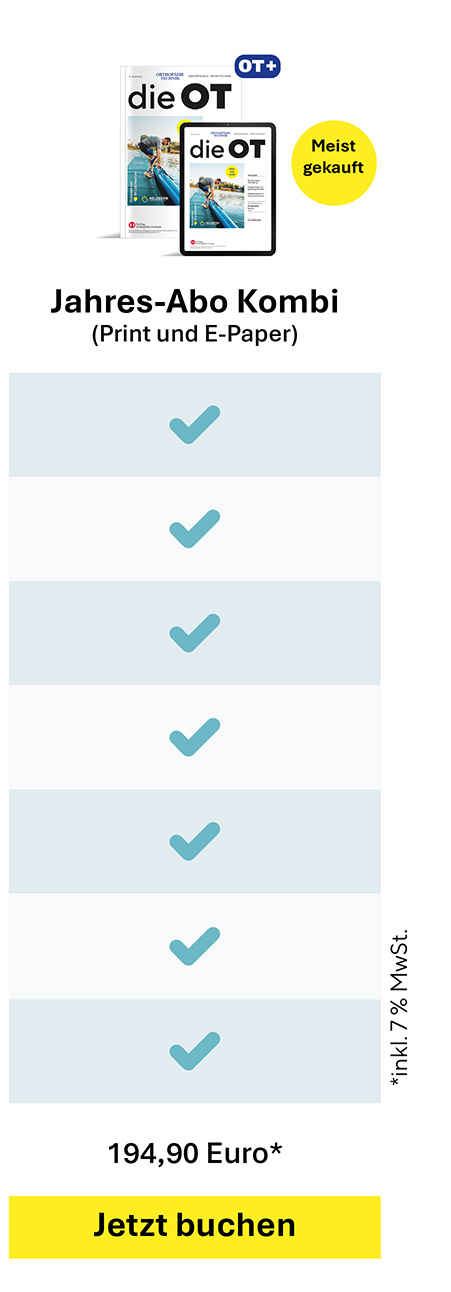Liner in der Unterschenkel-Prothetik
J. Becker
Bei Prothesenversorgungen an der unteren Extremität hat sich die Verwendung eines Liners durchgesetzt. Insbesondere bei Versorgungen transtibialer Stümpfe ist die Vielfalt der möglichen Linersysteme beachtlich. Diese Vielfalt bietet die Möglichkeit, den Anwender bedarfsgerecht zu versorgen, auch wenn es sich um besondere Stümpfe handelt. Jedoch ist hierfür Voraussetzung, die Eigenschaften der Linersysteme genau zu kennen, um eine passende Auswahl treffen zu können. Dieser Artikel zeigt eine Übersicht der Vielfalt von Linersystemen.