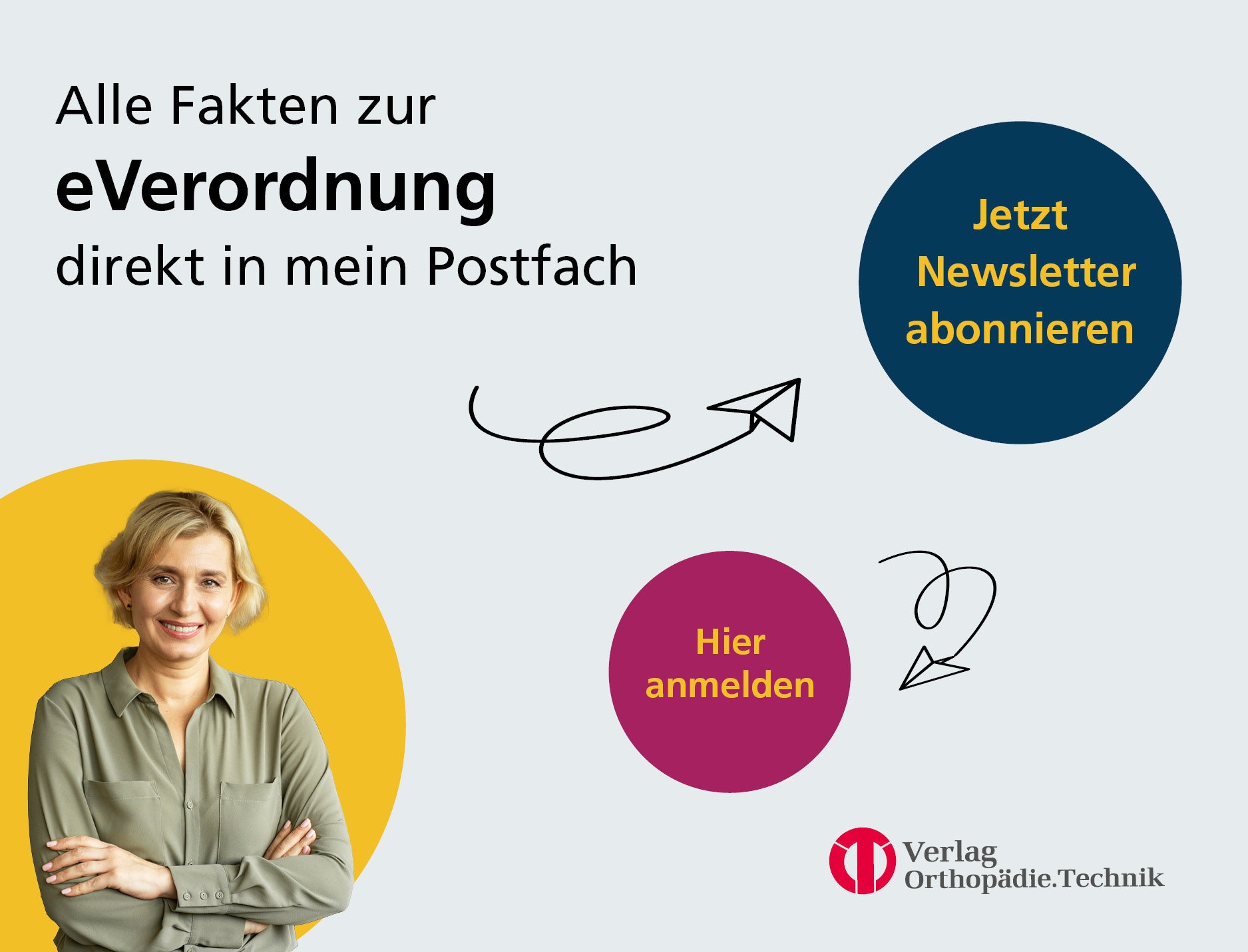Besonders kritisch sieht Prof. Dr. Frank Braatz, dass wichtige Akteure wie Orthopädie-Technik und Sanitätshäuser bislang von Lese- und Schreibrechten ausgeschlossen sind. Damit könne die ePA ihr Potenzial für eine interdisziplinäre Versorgung nicht ausschöpfen. Der Professor für Medizinische Orthobionik und Leiter des Schwerpunkts Technische Orthopädie der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie der Universitätsmedizin Göttingen erläutert im OT-Gespräch außerdem die Schnittstellen zur elektronischen Verordnung (eVO) und die Chancen, die beide Digitalisierungsprojekte gemeinsam bieten. Braatz ist 1. Vorsitzender der Vereinigung Technische Orthopädie (VTO). Diese ist eine offizielle Sektion der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie und zählt zu den Partnern des Pilotprojekts eVO für orthopädische Hilfsmittel unter Federführung des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT).
Herr Professor Braatz, mit der ePA verbinden sich große Hoffnungen: schnellere Informationsflüsse, bessere Abstimmung zwischen den Professionen, weniger Doppeluntersuchungen. Wird die Konzeption diesen Erwartungen gerecht?
Frank Braatz: Die Grundidee ist absolut richtig. Die ePA ist als strukturierte Datendrehscheibe angelegt, die theoretisch alle an der Versorgung Beteiligten einbezieht. Diagnosen, Befunde, Medikationsdaten und weitere Informationen sind mit Einwilligung der Patienten berechtigten Personen zugänglich. Allerdings bleibt die Umsetzung bislang hinter diesen Erwartungen zurück – vor allem, was die konsequente Einbindung aller Gesundheitsprofessionen betrifft.
Was leistet die ePA bislang in der Praxis – und wo liegen die Defizite?
Sie erleichtert die kontinuierliche Dokumentation und kann den Informationsaustausch über Einrichtungsgrenzen hinweg vereinfachen. Die Anbindung der haus- und fachärztlichen Praxen funktioniert technisch zunehmend besser. Der Zugriff auf Medikationspläne und ausgewählte Befunde ist bereits implementiert. Was die ePA aber nicht leistet: Wichtige Berufsgruppen sind (noch) ausgespart, etwa Orthopädietechniker und Orthopädieschuhtechniker. Die multiprofessionelle Idee einer gemeinsamen Patientenversorgung ist bisher nicht eingelöst, weil viele Berufsgruppen schlicht keinen Zugang haben. Außerdem lassen die Nutzerfreundlichkeit und Interoperabilität zu wünschen übrig.
Die ePA ist bisher also keine Erfolgsgeschichte?
Die Bilanz fällt in der Tat ernüchternd aus. Die tatsächliche Nutzung ist noch gering – sowohl bei Patienten als auch unter den leistungserbringenden Akteuren.
Woran liegt das?
Technische Hürden, Datenschutzbedenken und die mangelnde Einbindung wichtiger Berufsgruppen hemmen die Entwicklung. Für die Technische Orthopädie beispielsweise hat die ePA bislang in der täglichen Arbeit keinen Mehrwert. Solange zentrale Akteure nicht eingebunden sind, bleibt sie Stückwerk.
Für Orthopädietechniker und Sanitätshäuser zum Beispiel sind nach derzeitigem Stand gar keine Lese- oder Schreibrechte vorgesehen.
Aus Sicht einer modernen, patientenzentrierten Versorgung ist das ein Rückschritt. In der Technischen Orthopädie kooperieren wir besonders eng und gleichberechtigt mit Orthopädietechnikern und anderen Fachleuten. Hier laufen viele Fäden zusammen: Die Versorgung mit Prothesen, Orthesen und Einlagen sowie die laufende Optimierung und Anpassung gelingen nur durch umfassende gemeinsame Dokumentation und Kommunikation. Bleiben diese Berufsgruppen ausgeschlossen, bleibt die ePA ein Torso und schöpft ihr Potenzial nicht aus. Wer diese Akteure und ihre Expertise nicht berücksichtigt, riskiert Brüche im Versorgungsprozess.

Unter welchen Voraussetzungen könnte die ePA eine Erfolgsgeschichte werden?
Da gibt es mehrere Stellschrauben. Dazu gehören offene Schnittstellen, standardisierte Datenformate und Interoperabilität. Außerdem braucht es die Beteiligung aller Professionen – einschließlich Gesundheitshandwerk – mit abgestuften Rechten. Die Anwendungen dürfen keinen zusätzlichen Aufwand erzeugen, sondern sollten Prozesse spürbar vereinfachen. Wenn digitale Dokumentation zusätzlich zu bestehenden Formularen kommt, statt sie zu ersetzen, führt das zu Frustration. Schnellere Genehmigungen durch strukturiert abrufbare Daten wären ebenfalls ein echter Mehrwert. Datenschutz und ‑sicherheit auf hohem Niveau sind ebenso nötig wie flankierende Maßnahmen: Fortbildungen, Kommunikation und faire Vergütungsmodelle, die den Mehraufwand abbilden. Das ist derzeit nicht ausreichend geregelt.
Die Einbindung der Hilfsmittelleistungserbringer in die ePA ist Ihrer Meinung nach essenziell?
Ja, die Hilfsmittelleistungserbringer müssen gleichberechtigte Nutzer der ePA werden – mit Lese- und bedarfsgerechten Schreibrechten. Damit könnte die ePA zu dem werden, was sie eigentlich sein sollte: Rückgrat einer multiprofessionellen, digital unterstützten Patientenversorgung.
Welche Vorteile hätte eine Verzahnung von eVO und ePA?
Eine Integration der eVO in die ePA wäre absolut sinnvoll. Verordnungen wären strukturiert hinterlegt, alle Beteiligten könnten darauf zugreifen. Das beschleunigt Abläufe und verbessert die Dokumentationsqualität. Bei komplexen Versorgungen wäre das ein entscheidender Vorteil. Ein vollständiger Überblick der Hilfsmittelversorgungen bietet zudem die Chance, Fehl- und Überversorgungen zu vermeiden.
Welche Rolle können ePA und eVO langfristig für die Hilfsmittelversorgung spielen?
Richtig umgesetzt, schaffen beide Instrumente eine lückenlose Dokumentation von Versorgungspfaden – von der Indikation über die Umsetzung bis zur Erfolgskontrolle. Das steigert Qualität, Transparenz und Versorgungssicherheit. Langfristig können eVO und ePA einander ideal ergänzen.
Die eVO soll ab 1. Juli 2027 verpflichtend eingeführt werden. Wie schätzen Sie den Stand ein?
Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen hinken dem Zeitplan hinterher. Ohne elektronischen Berufsausweis – kurz eBA – und die Institutionskarte SMC‑B (Security Module Card Typ‑B. Anm. d. Red), bei denen es starke Verzögerungen gibt, können Betriebe gar nicht am digitalen Gesundheitsnetz teilnehmen. Der Starttermin erscheint unter diesen Umständen ambitioniert.
Was ist bis zur Einführung der eVO besonders wichtig?
Die frühzeitige, praxistaugliche Einbindung aller betroffenen Akteure. Technische Lösungen müssen stabil und anwenderorientiert sein. Es muss uns gelingen, Prozesse zu verschlanken. Die Digitalisierung darf nicht in endlosen Begründungspflichten und zusätzlicher Bürokratie münden. Das wünsche ich mir als Verordner.
Die Fragen stellte Cathrin Günzel.
Updates zum Pilotprojekt eVO für BIV-OT-Mitgliedsbetriebe liefert der Newsletter „eVO-Aktuell“. Interessierte können sich im Mitgliederbereich unter dem Menüpunkt Newsletter anmelden. Wer sich aktiv beteiligen will (zum Beispiel Mitgliedsbetriebe, Kostenträger oder PVS-Anbieter), meldet sich unter: telematik@biv-ot.org
Die Projektleitung informiert anschließend über Details.
Die vorherigen Artikel der Reihe zur eVerordnung lesen Sie hier:
Teil 1: Reibungslos von Papier zu digital
Teil 2: Pilotprojekt eVerordnung nimmt weiter Fahrt auf
Teil 3: eVerordnung: HMV bedarf Überarbeitung
Teil 4: eVerordnung: Sonderprozesse mitdenken
Teil 5: Pilotprojekt eVO setzt auf offene Schnittstellen
Teil 6: Qualitative Testphase treibt Pilotprojekt voran
Teil 7: eVO-Pilotprojekt: Status quo, Fortschritte und offene Baustellen
Teil 8: eVerordnung im Praxischeck des Pilotprojekts
- Ein Ort des interdisziplinären Austauschs — 10. Februar 2026
- eVerordnung: Datenmodelle statt Papierberge — 9. Februar 2026
- Eine Socke, die fühlen lässt — 6. Februar 2026