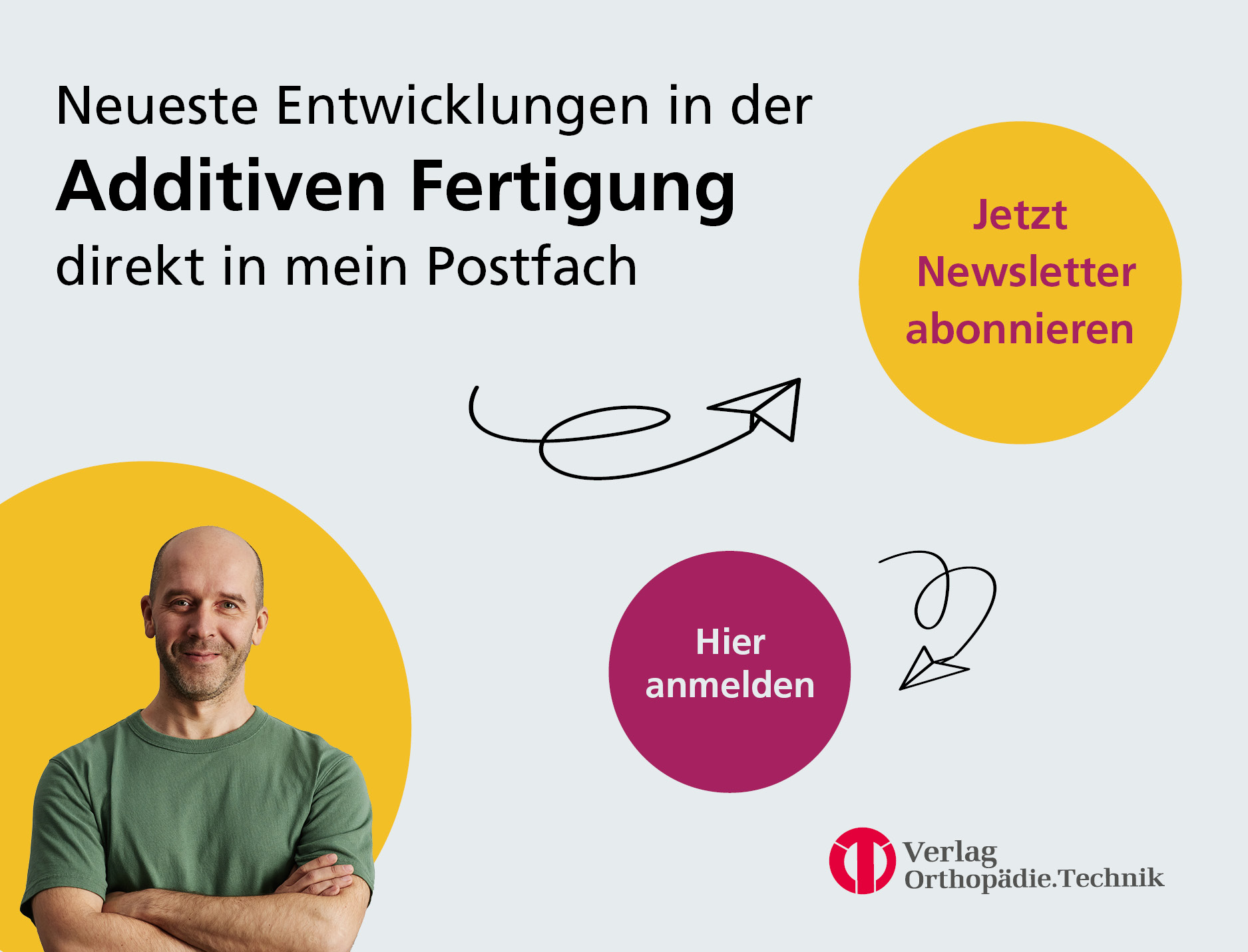Wer einmal durch die Messehallen der Formnext in Frankfurt geht, der spürt: Additive Fertigung – das ist etwas für Gegenwart und Zukunft. Vielleicht keine industrielle Revolution 2.0, wie die Künstliche Intelligenz (KI) die Industrie, Dienstleistungen und Verwaltung nachhaltig verändert, aber mit Sicherheit ein neuer Horizont in Sachen maschineller Fertigung. Und die Entwicklung der beteiligten Hard- und Software nimmt von Monat zu Monat Geschwindigkeit auf. Aber steckt der 3D-Druck wirklich noch in den Kinderschuhen? Die Antwort darauf lautet nein.
Hull ist Geburtshelfer des heutigen 3D-Drucks
Bereits vor ungefähr vier Jahrzehnten entwickelte und patentierte der amerikanische Physiker Chuck Hull den ersten 3D-Drucker. Zur schichtweisen Fertigung dreidimensionaler Objekte wurden räumliche Daten in digitaler Form an einen Extruder geschickt. Ein Extruder ist eine Maschine, die feste oder dickflüssige Materialien wie Kunststoff, Gummi oder sogar Lebensmittel unter hohem Druck und hoher Temperatur durch eine formgebende Düse presst. Bei Hull beruhte das Druckverfahren auf seinem Patent für die Aushärtung lichtempfindlicher Polymere durch UV-Strahlung, Hinzufügen von Partikeln, chemischen Reaktionen oder Laserstrahlen. Unter dem Namen „SLA‑1“ erlangte der erste 3D-Drucker die Marktreife und kam 1987 in den Verkauf.
Parallel entwickelte Scott Crump 1989 das Fused Deposition Modeling (FDM), bei dem geschmolzener Kunststoff durch eine beheizte Düse extrudiert wird. Sein Unternehmen Stratasys setzte auf ABS-Kunststoff – das gleiche Material, aus dem Lego-Steine bestehen. Plötzlich konnten nicht nur lichtempfindliche Harze, sondern auch thermoplastische Kunststoffe verarbeitet werden.
Ein Kassenschlager wurde die Technologie nicht, da trotz des Potentials für beispielsweise den schichtweisen Aufbau von komplexen Werkstücken, die Industrie noch nicht so weit war und auch der Einführungspreis von 300.000 US-Dollar abschreckte. Eine Zukunftstechnologie ohne Zukunft also?
Millennium-Boost für 3D-Druck
Die Jüngeren werden sich daran nicht erinnern können, doch im Jahr 1999 beschäftigte viele Nutzer von Computern eine Frage: Wird mein PC noch am 1. Januar 2000 funktionieren? Ganze Fernsehsendungen, Zeitungsartikel und Radiobeiträge wurden diesem Thema gewidmet. Doch als die Zeiger der Uhr an Silvester die Mitternacht passierten, passiert nichts, außer, dass die Computer weiterhin funktionierten. Ein digitaler Super-GAU blieb also aus, doch die Beschäftigung mit dem Thema PC in der Öffentlichkeit, brachte neue Aufmerksamkeit zu den noch nicht entfalteten Potenzialen dieser Geräte. Auch der 3D-Druck wurde als Nutzungsmöglichkeit identifiziert.
Die Medizintechnik war eine der ersten Branchen, die das Potenzial erkannte. Schon in den frühen 2000er-Jahren begannen unter anderem Orthopädietechniker, individuelle Prothesen digital zu konstruieren und zu drucken. Als einer der Meilensteine lässt sich das Jahr 2005 benennen, als neue biokompatible Kunststoffe wie medizinisches Nylon und spezielles TPU (Thermoplastisches Polyurethan) verfügbar wurden.

Die Materialschlacht: Kunststoffe für jeden Zweck
Die 2010er-Jahre brachten eine wahre Explosion neuer 3D-Druck-Materialien. Was einst mit wenigen Standard-Kunststoffen begann, entwickelte sich zu einem Arsenal hochspezialisierter Werkstoffe für jeden erdenklichen Einsatz.
High-Performance-Polymere wie PEEK (Polyetheretherketon) eroberten die Medizintechnik. Dieser Superkunststoff ist nicht nur biokompatibel, sondern auch röntgendurchlässig – perfekt für Implantate, die nicht bei jeder Untersuchung stören. Mit einem Schmelzpunkt von über 300 Grad Celsius ist PEEK allerdings anspruchsvoll zu drucken und erfordert entsprechend teure Drucker.
Am anderen Ende des Spektrums etablierten sich wasserlösliche Stützmaterialien wie PVA und HIPS. Sie ermöglichten komplexere Geometrien, da überhängende Strukturen gedruckt und die Stützen anschließend einfach aufgelöst werden konnten.
Besonders spannend wurde die Entwicklung von Verbundwerkstoffen. Kunststoffe mit Kohlefaser-Verstärkung erreichten die Festigkeit von Aluminium bei einem Bruchteil des Gewichts. Glas- und Kevlar-verstärkte Filamente brachten weitere Eigenschaften ins Spiel – von elektrischer Isolierung bis zu extremer Schlagfestigkeit.
Geschwindigkeit und Präzision: die technische Evolution der Drucker
Parallel zur Materialentwicklung machten auch die Drucker selbst gewaltige Sprünge. Die ersten SLA-Drucker von 1988 benötigten Stunden für kleine Objekte und erreichten bestenfalls 0,1 Millimeter Auflösung. Moderne Resin-Drucker schaffen heute Details von 0,01 Millimetern – zehnmal feiner als ein menschliches Haar.
Der Durchbruch kam mit LCD-basierten Druckern um 2016. Statt jeden Punkt einzeln mit einem Laser zu belichten, härteten diese Geräte ganze Schichten gleichzeitig aus. Ein Objekt, für das frühere Generationen einen ganzen Tag brauchten, war plötzlich in zwei Stunden fertig.
Auch FDM-Drucker wurden revolutioniert. Multi-Material-Systeme können bis zu fünf verschiedene Kunststoffe gleichzeitig verarbeiten. Wasserlösliche Stützen, farbige Akzente oder die Kombination von starren und flexiblen Bereichen in einem Bauteil sind dadurch möglich geworden.
Die Temperaturkontrolle wurde immer präziser. Moderne Drucker überwachen nicht nur die Düsen- und Betttemperatur, sondern die gesamte Baukammer. Das ermöglicht das Verarbeiten anspruchsvoller Hochleistungskunststoffe, die früher nur in Industrieanlagen gedruckt werden konnten.
Von der Garage zur Fabrik: industrieller 3D-Druck
Was in Hobbykellern begann, eroberte schnell die Fabrikhallen. Industrielle 3D-Drucker sind heute wahre Fertigungsmonster – mit Bauraum-Größen von mehreren Kubikmetern und der Fähigkeit, rund um die Uhr zu produzieren.
Besonders beeindruckend ist die Entwicklung des Pulverbettverfahrens (SLS – Selective Laser Sintering). Hier wird Kunststoffpulver schichtweise mit einem Laser verschmolzen. Da unverschmolzenes Pulver als natürliche Stütze dient, sind extrem komplexe Geometrien möglich – hohle Strukturen, bewegliche Gelenke oder ineinander verschachtelte Bauteile.
Neue Kunststoffe für industrielle Anwendungen bringen extreme Eigenschaften mit: flammhemmende Materialien für die Luftfahrt, antistatische Compounds für die Elektronik oder UV-beständige Formulierungen für Außenanwendungen.
Die Zukunft ist schon da: aktuelle Trends und Ausblick
Der 3D-Druck steht heute an einem Wendepunkt. Was einst Prototyping-Technologie war, wird zunehmend zur Serienfertigung. Adidas druckt mittlerweile Millionen von Schuhsohlen, Automotive-Zulieferer produzieren Endverbrauchsteile, und in der Orthopädie-Technik sind gedruckte Hilfsmittel längst Standard.
Die neuesten Entwicklungen versprechen weitere Quantensprünge. Multi-Jet-Fusion (MJF) von HP kann verschiedene Eigenschaften innerhalb eines Bauteils realisieren – harte und weiche Bereiche, leitfähige und isolierende Zonen oder verschiedene Farben. Carbon hat mit seinem DLS-Verfahren (Digital Light Synthesis) die Geschwindigkeit noch einmal dramatisch gesteigert – was früher Stunden dauerte, ist in Minuten erledigt.
Besonders spannend ist die Entwicklung neuer nachhaltiger Materialien. Recycelte Kunststoffe, ozeanplastik-basierte Filamente und sogar aus Algen gewonnene Polymere zeigen, dass 3D-Druck Teil der Lösung für unsere Umweltprobleme werden kann, statt sie zu verstärken.
Nachhaltigkeit: Recycling statt Abfall
Ein oft übersehener Aspekt des 3D-Drucks ist sein Nachhaltigkeitspotenzial. Traditionelle Fertigung ist subtraktiv – aus einem großen Block wird das gewünschte Teil herausgefräst, der Rest ist Abfall. 3D-Druck ist additiv – es wird nur Material verwendet, das auch im Endprodukt landet.
Moderne Recycling-Systeme können alte Drucke wieder zu neuem Filament verarbeiten. Unternehmen wie Polymaker haben geschlossene Kreislaufsysteme entwickelt, bei denen aus Fehldrucken und Stützmaterial wieder hochwertiges Druckmaterial wird.
Heiko Cordes
PLA: einsteigerfreundlich, biologisch abbaubar
ABS: robust, hitzebeständig, chemikalienresistent
PETG: klar, lebensmittelecht, einfach zu drucken
TPU: flexibel, gummiartig, stoßdämpfend
Nylon (PA): sehr fest, verschleißresistent, chemikalienbeständig
PEEK: Hochleistungskunststoff für Implantate
PVA: wasserlöslich, für Stützstrukturen
Hier finden Sie alle Artikel unserer dreiteiligen Serie „Additive Fertigung“:
„Additive Fertigung – Teil 1: Scannen“
- Der Weg in die Additive Fertigung
- 3D-Scanner im Überblick
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Per Korrekturgestell zum individuellen Korsett
- Mit Punktwolke zur Präzision
„Additive Fertigung – Teil 2: Konstruieren“
- Wie digitales Konstruieren die Orthopädie-Technik verändert
- Formvollendet: Software im Überblick
- Atemfreiraum geben – Praxisbeispiel zur Implementierung digitaler Workflows in der Korsettversorgung
- „Easy“ Einlagenkonstruktion – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Höchste Präzision gefordert – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Gut modelliert wird doppelt belohnt
„Additive Fertigung – Teil 3: Fertigen“
- Die Revolution aus dem Drucker – Eine (kurze) Geschichte des 3D-Drucks
- 3D-Druckverfahren im Überblick: Wo welches System seine Stärken ausspielt
- Wenn es da ist, muss es passen – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Wie eine zweite Haut – Praxisbeispiel zur Implementierung eines digitalen Workflows in der Versorgung
- Premiere geklappt, Fortsetzung folgt – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Warum gute Ergebnisse mehr als nur Technik brauchen
- eVerordnung: Nicht ausbremsen lassen! — 6. Januar 2026
- Manfred Hinz neu im BVMed-Vorstand — 6. Januar 2026
- Focus CP/Rehakind-Kongress lockt mit Programmvielfalt — 5. Januar 2026