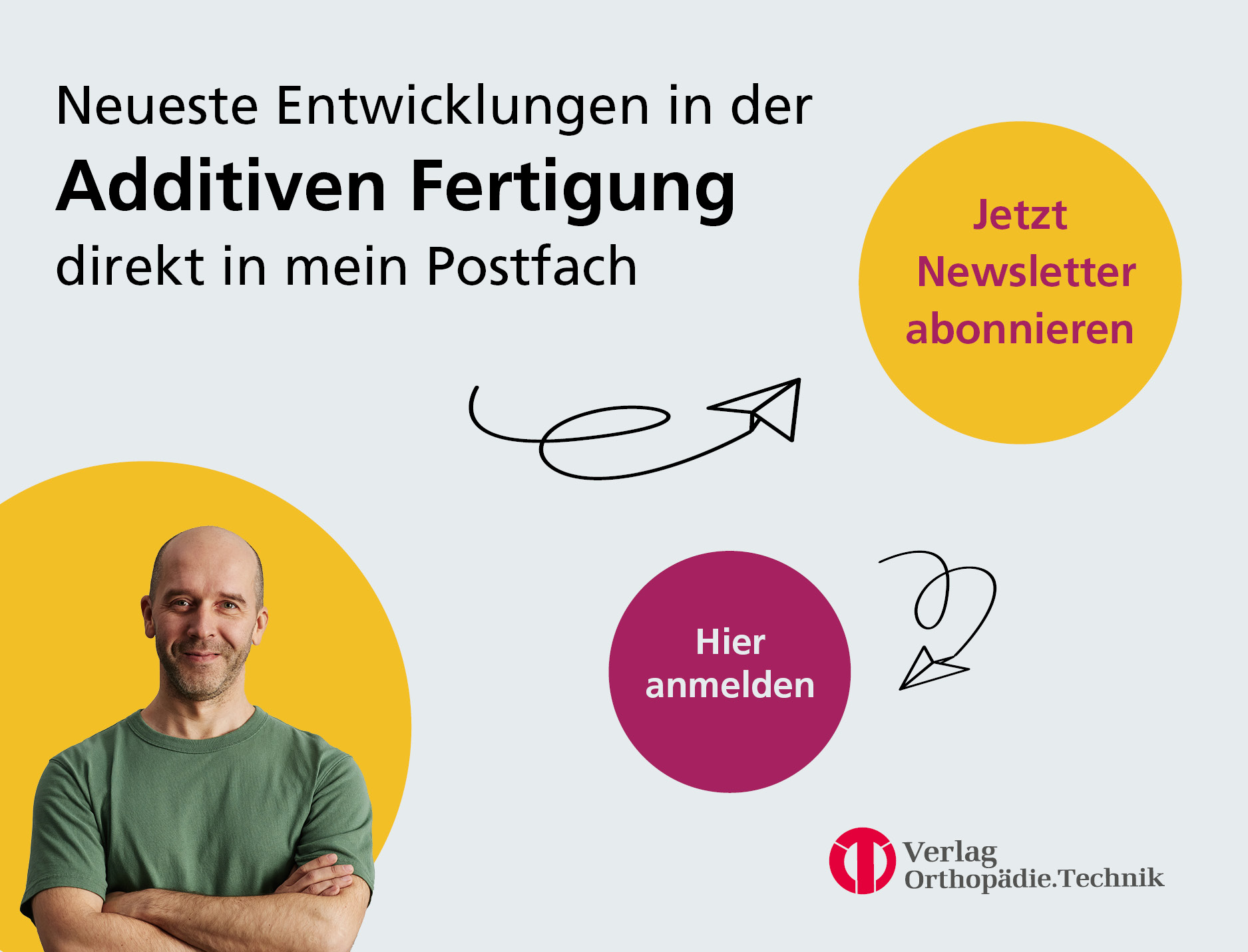Grundlagen des digitalen Konstruierens für 3D-Druck
Digitales Konstruieren für die Additive Fertigung unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Konstruktionsmethoden. Während bei der umformenden Fertigung geometrische Beschränkungen durch Werkzeuge oder Fertigungsverfahren bestehen, ermöglicht der 3D-Druck nahezu beliebige Geometrien – theoretisch. In der Praxis sind jedoch verschiedene Faktoren zu beachten.
CAD-Programme (CAD = Computer-Aided Design) bilden das Fundament des digitalen Konstruierens. Sie ermöglichen es, dreidimensionale Modelle zu erstellen, die anschließend in maschinenlesbare Daten umgewandelt werden. Dieser Prozess, das sogenannte Slicing, zerlegt das digitale Modell in einzelne Schichten, die der 3D-Drucker nacheinander aufbaut.
Die Vorteile digitaler Konstruktion liegen auf der Hand: Änderungen lassen sich ohne Materialverlust vornehmen, verschiedene Varianten können parallel entwickelt werden, und die Daten können problemlos zwischen verschiedenen Standorten ausgetauscht werden. Simulationen ermöglichen es zudem, das Verhalten des Bauteils unter verschiedenen Belastungen bereits vor der Fertigung zu testen.
Nachteile zeigen sich vor allem in der Komplexität der Software und der Notwendigkeit spezialisierter Kenntnisse. Die Lernkurve ist steil, und nicht jede Geometrie, die digital konstruierbar ist, lässt sich auch wirtschaftlich fertigen. Stützstrukturen, Schichtaufbau und materialspezifische Eigenschaften müssen bereits im Konstruktionsprozess berücksichtigt werden.
▪ Digitales Konstruieren eröffnet neue Optionen für Bauteile.
▪ Es können in der Konstruktion bereits Tests simuliert werden, um Eigenschaften und Reaktionen zu testen.
▪ KI wird zum Tempomacher in Sachen Umwandlung von Bilddateien in Konstruktionen.
Von einfachen Prototypen zu komplexen Strukturen
Die Geschichte des 3D-Drucks beginnt in den 1980er-Jahren mit Chuck Hulls Stereolithografie. Damals beschränkte sich das Modellieren auf einfache geometrische Formen, die hauptsächlich zur Visualisierung dienten. Die verwendeten CAD-Programme waren rudimentär, und die Druckauflösung ließ präzise Strukturen kaum zu.
In den 1990er- und 2000er-Jahren entwickelten sich sowohl die Hardware als auch die Software weiter. Parametrische Modellierung ermöglichte es, Bauteile durch veränderbare Parameter anzupassen. Programme wie Solid-Works oder Autodesk Inventor etablierten sich als Industriestandard. Gleichzeitig entstanden erste spezialisierte Tools für die Additive Fertigung, die druckspezifische Anforderungen berücksichtigten.
Der Durchbruch kam mit der Entwicklung leistungsfähiger Computer und verbesserter Algorithmen. Topologieoptimierung – ein Verfahren zur automatischen Materialverteilung unter Berücksichtigung von Belastungen – revolutionierte das Konstruieren für den 3D-Druck. Strukturen, die mit herkömmlichen Methoden nicht herstellbar waren, wurden plötzlich möglich.
Heute ermöglichen generative Design-Ansätze und Künstliche Intelligenz (KI) es, dass Computer eigenständig Konstruktionslösungen vorschlagen. Die Software berücksichtigt dabei nicht nur mechanische Anforderungen, sondern auch Fertigungsrestriktionen und Materialkosten.

Spezifische Anforderungen
Die Orthopädie-Technik stellt besondere Anforderungen an das digitale Konstruieren. Jeder Patient ist anatomisch einzigartig, was individuelle Lösungen erforderlich macht. Gleichzeitig müssen strenge medizinische und regulatorische Vorgaben eingehalten werden.
Die Datengrundlage bilden meist Scan-Aufnahmen, die in 3D-Modelle umgewandelt werden. Diese dienen als Basis für die Konstruktion von Prothesen, Einlagen oder Orthesen.
Ein zentraler Aspekt ist die Biokompatibilität. Nicht jedes Material, das sich technisch verarbeiten lässt, ist für den dauerhaften Kontakt mit dem menschlichen Körper geeignet. Die Konstruktion muss daher von Anfang an auf zertifizierte Materialien ausgelegt sein. Zudem sind die mechanischen Anforderungen komplex.
Orthopädische Hilfsmittel stellen spezifische Herausforderungen an das digitale Konstruieren. Bei Prothesenschäften beispielsweise ist die exakte Anpassung an den Stumpf entscheidend für den Tragekomfort. Traditionell erfolgte dies durch – nicht selten zeitaufwendige – Anpassungsschritte am Patienten. Mit digitaler Konstruktion können verschiedene Varianten simuliert und optimiert werden, bevor das erste physische Exemplar entsteht.Gitterstrukturen haben sich als vielversprechender Ansatz erwiesen. Sie reduzieren das Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Die Konstruktion solcher Strukturen erfordert jedoch spezialisierte Software und tiefes Verständnis der biomechanischen Zusammenhänge.
Zukunftsperspektiven
Ein Blick in andere Branchen zeigt, dass die Entwicklung weiter in Richtung vollautomatisierter Konstruktionsprozesse geht. Auch im Bereich der Gesundheitsversorgung wird dieser Trend wahrscheinlich Einzug halten. Künstliche Intelligenz soll künftig beispielsweise aus medizinischen Bilddaten direkt optimierte Konstruktionen ableiten. Cloudbasierte Plattformen ermöglichen es, Expertenwissen global zu teilen und Konstruktionsprozesse zu standardisieren. Virtual und Augmented Reality bieten zudem neue Möglichkeiten für die Konstruktionsvalidierung. Die Integration von Sensoren in gedruckte Hilfsmittel eröffnet neue Perspektiven für die Überwachung und Anpassung und ist bereits heute in einigen Versorgungen schon Realität.
Hier finden Sie alle 6 Artikel unserer Serie „Additive Fertigung – Teil 2: Konstruieren“:
- Wie digitales Konstruieren die Orthopädie-Technik verändert
- Formvollendet: Software im Überblick
- Atemfreiraum geben – Praxisbeispiel zur Implementierung digitaler Workflows in der Korsettversorgung
- „Easy“ Einlagenkonstruktion – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Höchste Präzision gefordert – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Gut modelliert wird doppelt belohnt
Für alle, die Teil 1 der Serie „Additive Fertigung“ noch nicht kennen:
Hier finden Sie alle 6 Artikel unserer Serie „Additive Fertigung – Teil 1: Scannen“:
- Der Weg in die Additive Fertigung
- 3D-Scanner im Überblick
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Per Korrekturgestell zum individuellen Korsett
- Mit Punktwolke zur Präzision
- OTWorld macht Orthopädie-Schuhtechnik erlebbar — 13. Februar 2026
- Bufa-Meisterkurs sichert sich Basiszertifizierung — 12. Februar 2026
- Ein Ort des interdisziplinären Austauschs — 10. Februar 2026