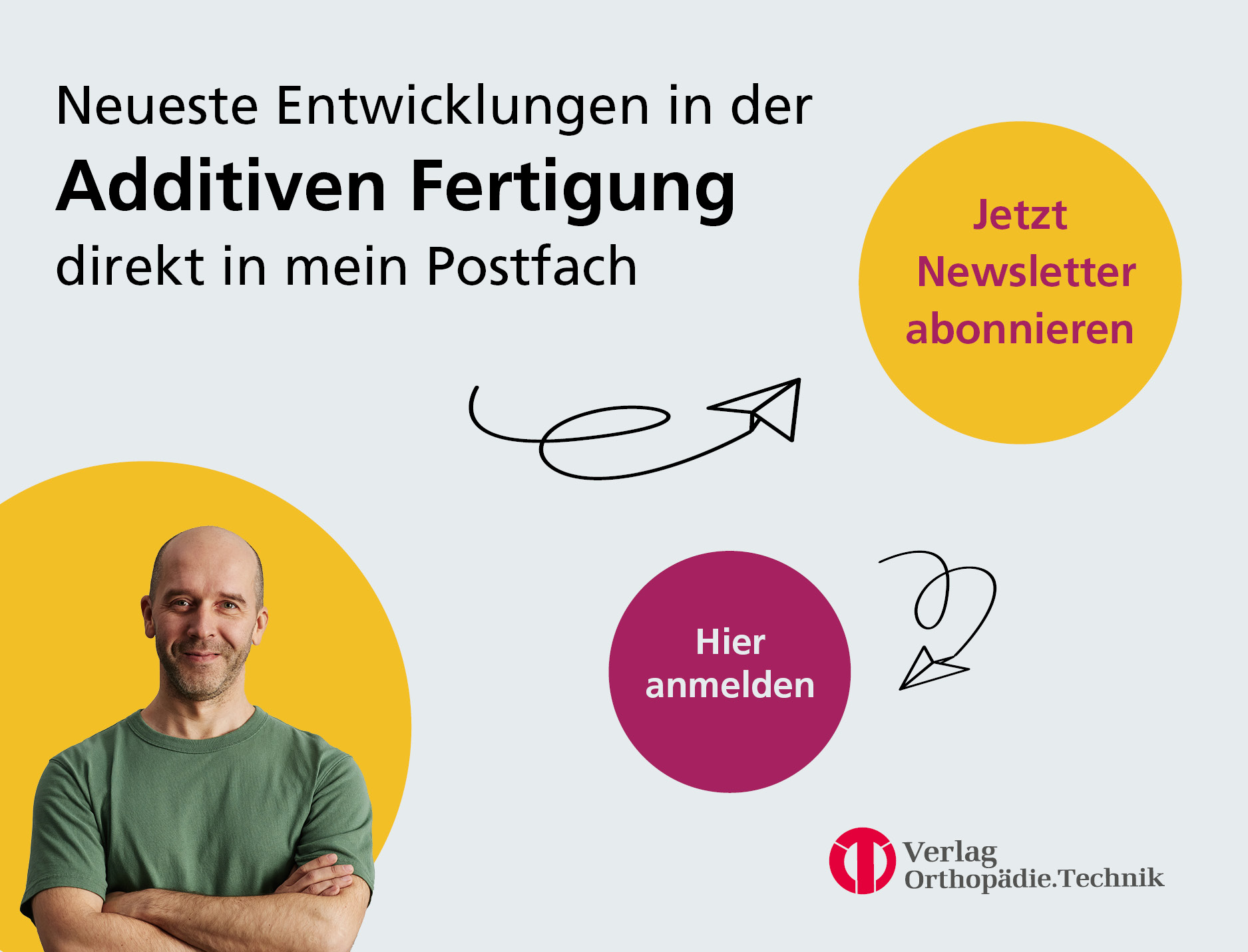Wo welches System seine Stärken ausspielt
„Der 3D-Druck hat, besonders in den vergangenen zwei Jahren, einen großen Sprung gemacht“, sagt Leopold Strey, Head of Business Development bei 3Dmensionals. „Gerade im FDM-Bereich ist es inzwischen sehr einfach, von der Datei zum Bauteil zu kommen. Man muss kein Techniker mehr sein, um gute Ergebnisse zu erzielen.“ Das Spektrum erstreckt sich vom kompakten FDM-Drucker bis zur professionellen SLS-Anlage – und jedes System hat seine Stärken, Grenzen und Zielgruppen. Strey kennt die Bandbreite aus der täglichen Beratungspraxis: „Entscheidend ist, was man drucken will, wie groß, mit welchem Material und mit welcher Weichheit.“
Während FDM-Drucker vor allem durch günstige Anschaffungskosten und unkomplizierte Bedienung punkten, bieten SLS-Drucker deutlich mehr Designfreiheit und Materialvielfalt – sind aber teurer in der Anschaffung. Ergänzt wird das Feld durch SLA-Systeme, die in der Orthopädie-Technik bislang eine eher untergeordnete Rolle spielen. Der folgende Überblick zeigt, welche Druckverfahren sich in der Orthopädie-Technik und Orthopädie-Schuhtechnik etabliert haben – und worauf es bei der Auswahl ankommt.

„Man sollte immer von der Anwendung ausgehen – und daraus das passende Material und den geeigneten Drucker ableiten“, so Leopold Strey. Foto: 3Dmensionals
Fused Deposition Modeling (FDM)
Fused Deposition Modeling (FDM) ist laut Strey das am weitesten verbreitete Verfahren im orthopädietechnischen Alltag, auch weil viele Betriebe die Geräte aus dem Heimgebrauch kennen, und eignet sich gut für Einsteiger. FDM-Druck arbeitet mit thermoplastischem Kunststoff in Form von Filamenten. Dieses Filament wird erhitzt und Schicht für Schicht aufgetragen, wobei jede neue Schicht an der darunterliegenden haftet. „Viele Betriebe favorisieren Geräte von Bambu Lab, etwa die Modelle H2S und H2D“, so Strey.

Der H2S bietet mit einem Bauraum von rund 340 × 320 × 340 Millimetern genügend Platz, um Einlagen, Orthesen oder auch Oberschenkelschäfte zu drucken. Zudem verfügt er über eine hohe Druckgeschwindigkeit bei geringem Geräuschpegel – ein wichtiges Argument für den Werkstatteinsatz. Die Variante H2D kann zusätzlich unterschiedlich weiche Kunststoffe miteinander kombinieren, was besonders für die Fertigung von Orthesen von Vorteil sein kann.
Als Alternativen nennt Strey den Prusa XL und den Ultimaker S6. Der Prusa XL bietet den größten Bauraum im Vergleich (36 cm Kantenlänge) und kann bis zu fünf Materialien gleichzeitig verarbeiten – ideal für komplexe Geometrien oder Materialkombinationen. Der Ultimaker S6 überzeugt durch seine hohe Präzision und ein geschlossenes System mit zertifizierter IT-Sicherheit – ein Pluspunkt für Betriebe, die sensible Patientendaten schützen müssen. Im Unterschied zu den cloudbasierten Bambu-Lab-Geräten arbeitet der Ultimaker vollständig lokal über Netzwerk oder USB-Stick.

In der Praxis punkten FDM-Drucker vor allem durch ihre günstigen Anschaffungskosten (ab etwa 1.100 Euro), den überschaubaren Wartungsaufwand und die große Materialvielfalt. Grenzen zeigt das Verfahren bei sehr weichen Materialien oder wenn besonders glatte Oberflächen gefordert sind. Oft werden zusätzliche Stützstrukturen benötigt, um komplexe Formen zu drucken.
„Man sollte immer von der Anwendung ausgehen – und daraus das passende Material und den geeigneten Drucker ableiten“, betont Strey. Am Ende sei es zum Teil auch Geschmackssache. „Wir empfehlen, sich vor dem Kauf die Software des jeweiligen Druckerherstellers herunterzuladen – die ist immer kostenfrei.“ Damit könne man „einfach mal ein bisschen herumexperimentieren und schauen, was gut für einen passt“. Denn, so Strey weiter: „Letztendlich hat man viel mit dem Drucker zu tun, aber natürlich auch mit der Software – das entsprechende Software-Paket muss dazu passen.“
Selektives Lasersintern (SLS)
Das Selektive Lasersintern (SLS) gilt als das Verfahren für professionelle Anwendungen und Serienfertigung. „SLS ist der heilige Gral für die großvolumige Produktion“, so Leopold Strey. Gearbeitet wird nicht mit Filament, sondern mit Kunststoffpulver, das Schicht für Schicht von einem Laser punktuell aufgeschmolzen wird. Da keine Stützstrukturen benötigt werden, bietet das Verfahren volle Designfreiheit. In der Orthopädie-Schuhtechnik wird SLS vor allem dann eingesetzt, wenn Einlagen oder komplexe Formen gefertigt werden sollen. Während FDM-Drucker meist für Einzelversorgungen genutzt werden, eignet sich SLS für halbautomatisierte oder seriennahe Prozesse.

Die Anschaffungskosten sind im Vergleich jedoch deutlich höher – Strey spricht von etwa 50.000 Euro je nach Ausstattung. Dafür liefern die Geräte sehr stabile Bauteile mit hoher Präzision und gleichbleibender Qualität. Als Hersteller ist in diesem Bereich beispielsweise Formlabs mit der „Fuse-Serie“ vertreten. Diese Systeme sind auf den professionellen Einsatz ausgelegt und können TPU-Materialien verarbeiten, wie sie für flexible, aber belastbare Einlagen oder Orthesenteile typisch sind.
Stereolithografie (SLA)
Das Stereolithografie-Verfahren (SLA) arbeitet mit flüssigen Harzen, die durch Licht ausgehärtet werden. In der Orthopädie-Technik spielt es derzeit eher eine Nebenrolle. „SLA ist in der Medizintechnik weiter verbreitet, insbesondere im Dentalbereich.“ Hersteller wie Formlabs bieten Geräte wie den Form 4L an, die mit biokompatiblen Harzen arbeiten können. Diese Systeme überzeugen durch sehr hohe Präzision und glatte Oberflächen und eignen sich daher für besonders feine Strukturen oder für den Druck von Silikongussformen.

Was Strey unabhängig vom Fertigungsverfahren zu Bedenken gibt: „Man sollte sich gut überlegen, ob man überhaupt einen eigenen Drucker braucht oder lieber auf einen Dienstleister zurückgreift, der mehr Verfahren abdecken und komplexere Bauteile realisieren kann.“ Oder aber man hilft sich gegenseitig: Strey erlebt die Branche als sehr hilfsbereit. „Gerade in Sanitätshäusern oder in orthopädietechnischen Werkstätten gibt es häufig Experten, die sich untereinander austauschen und unterstützen – das ist immer eine wertvolle Möglichkeit.“
Hier finden Sie alle Artikel unserer dreiteiligen Serie „Additive Fertigung“:
„Additive Fertigung – Teil 1: Scannen“
- Der Weg in die Additive Fertigung
- 3D-Scanner im Überblick
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Per Korrekturgestell zum individuellen Korsett
- Mit Punktwolke zur Präzision
„Additive Fertigung – Teil 2: Konstruieren“
- Wie digitales Konstruieren die Orthopädie-Technik verändert
- Formvollendet: Software im Überblick
- Atemfreiraum geben – Praxisbeispiel zur Implementierung digitaler Workflows in der Korsettversorgung
- „Easy“ Einlagenkonstruktion – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Höchste Präzision gefordert – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Gut modelliert wird doppelt belohnt
„Additive Fertigung – Teil 3: Fertigen“
- Die Revolution aus dem Drucker – Eine (kurze) Geschichte des 3D-Drucks
- 3D-Druckverfahren im Überblick: Wo welches System seine Stärken ausspielt
- Wenn es da ist, muss es passen – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Wie eine zweite Haut – Praxisbeispiel zur Implementierung eines digitalen Workflows in der Versorgung
- Premiere geklappt, Fortsetzung folgt – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Warum gute Ergebnisse mehr als nur Technik brauchen
- OTWorld macht Orthopädie-Schuhtechnik erlebbar — 13. Februar 2026
- Bufa-Meisterkurs sichert sich Basiszertifizierung — 12. Februar 2026
- Ein Ort des interdisziplinären Austauschs — 10. Februar 2026