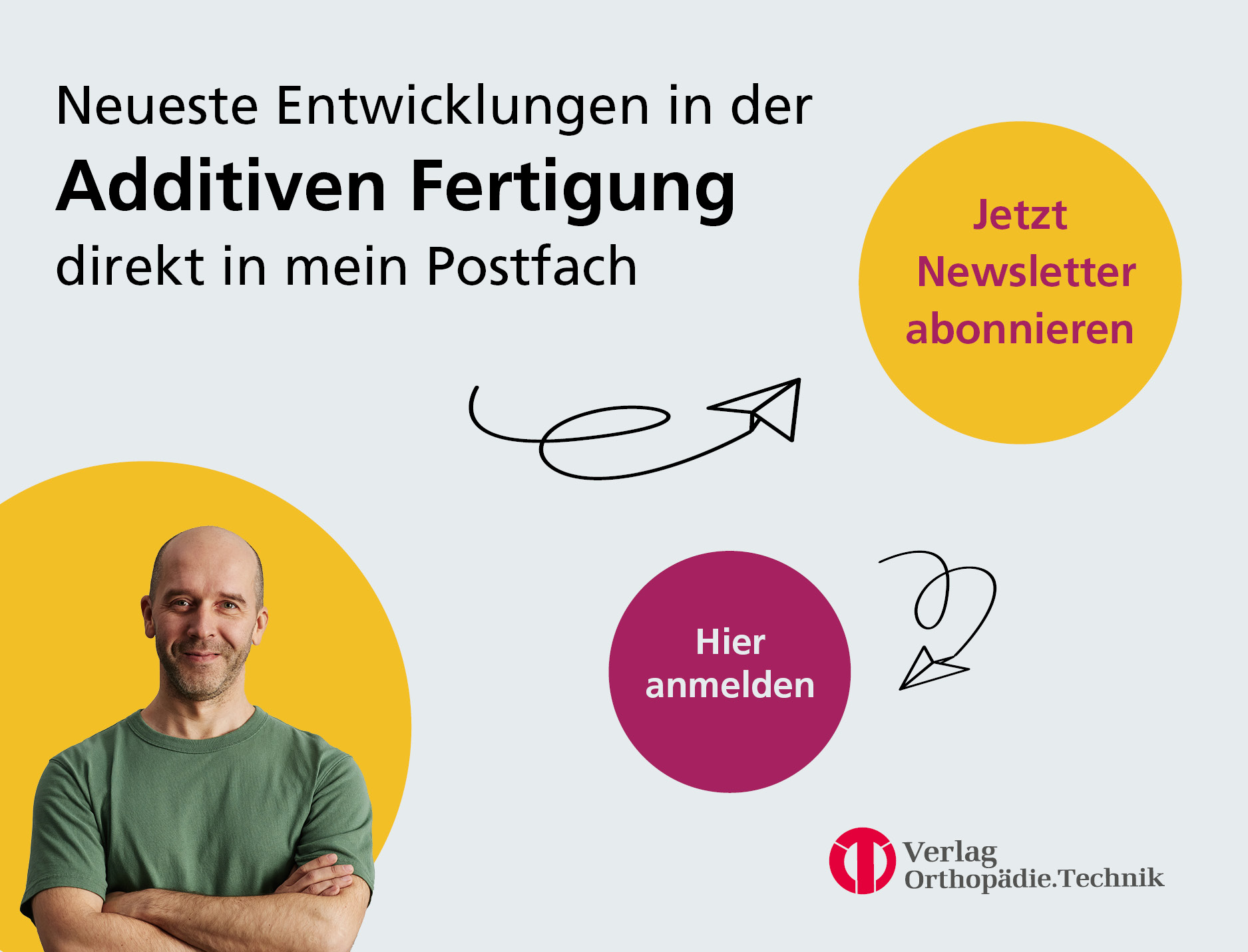Modellieren und Konstruieren sind in der digitalen Hilfsmittelfertigung der zweite Schritt im Fertigungsprozess. Wenn Sie dieser Aufgabe eine Gewichtung zusprechen müssten, wie wichtig ist das Modellieren für den Prozess?
Steffen Matyssek: Das Modellieren ist nach wie vor der entscheidende Arbeitsschritt bei der Herstellung unserer Sonderanfertigungen. Hier wird die Passform festgelegt und der Sitz des Hilfsmittels am Patienten definiert. Fehler an dieser Stelle des Herstellungsprozesses können bei der Anpassung und Abgabe zu erheblicher Mehrarbeit bis hin zur erneuten Produktion auf der Grundlage eines überarbeiteten Modells führen. Es lohnt sich also doppelt, an dieser Stelle sehr gewissenhaft zu arbeiten. Zum einen sorgen wir dadurch für den bestmöglichen Sitz des Hilfsmittels am Patienten und zum anderen ersparen wir uns unter Umständen viel zusätzliche Arbeitszeit für aufwendige Anpassungen bei der Anprobe.
Damit die digitale Modellierung des Körpermodells auch bestmöglich und vor allem einem Standardprozess folgend vonstattengehen kann, ist es ratsam, auch der Körperabformung die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Im Zuge dessen muss im Vorfeld festgelegt werden, wann welche Art der Körperabformung gewählt wird. 3D-Scanning, das Skalieren von Körpermodellen oder die klassische Gipstechnik haben ihre spezifisch festgelegten Einsatzgebiete. Im Besonderen bei der Erstellung von 3D-Scans im Bereich Orthetik können Scanwerkzeuge, wie Positionierungshilfen, ein wichtiges ergänzendes Werkzeug darstellen und den Gesamtprozess zuverlässiger machen.
Fazit: Ein guter Körperabdruck führt zu einem tendenziell besseren Modell, welches die Konstruktion eines voraussichtlich gut passenden Hilfsmittels ermöglicht. Das war schon immer so und bleibt auch in Zukunft ein entscheidender Faktor im individuellen Hilfsmittelbau.
Die Konstruktion des Hilfsmittels wirkt unter den vorangegangenen Argumenten bezüglich der Körpermodellerstellung schon fast unscheinbar. Der wichtigste Punkt bei der Konstruktion eines Hilfsmittels besteht darin, die geplante Fertigung bereits im Vorfeld eindeutig festgelegt zu haben, um Materialeigenschaften oder spezifische Auswirkungen des Druckverfahrens auf das Bauteil beachten zu können.
Sie haben Erfahrung im digitalen Modellieren und Konstruieren. Auf welche Software setzen Sie?
Wir setzen bei der organischen Modellierung und Konstruktion auf die Software Geomagic Freeform. Bei der Konstruktion von standardisierten Baugruppen – beispielsweise Gelenkanbindungen oder Adapteraufnahmen – greifen wir auf die CAD-Software Autodesk Fusion 360 zurück.
Warum haben Sie sich für diese Lösung entschieden?
Bei der Auswahl der Softwarelösung für die digitale Produktion waren uns zwei Dinge besonders wichtig. Zum einen wollten wir in der Lage sein, alle unsere Modelle und Hilfsmittelkonstruktionen frei und unabhängig bearbeiten zu können und zum anderen auch perspektivisch gesehen keine gestalterischen Grenzen zu haben.
Die Software Freeform erfüllt beide Aspekte hervorragend. Es können alle gängigen Datenformate offen verarbeitet werden, was uns auch den Datenaustausch zwischen Freeform und der Standard CAD-Software Fusion 360 erleichtert. Darüber hinaus bietet Freeform eine aus unserer Sicht einzigartige Fülle an Möglichkeiten für die Modellierung und organische Konstruktion über dessen Werkzeugpalette. Diese Kombination sorgt dafür, dass man in der digitalen Hilfsmittelproduktion auch wirklich jedes Hilfsmittelkonzept verwirklichen kann. Zusätzlich bietet uns Freeform die Möglichkeit, wiederkehrende Modellier- und Konstruktionsschritte zu automatisieren, wodurch sehr standardisiert und vor allem zeitsparend gearbeitet werden kann.
Haben Sie eine Entscheidungshilfe für Einsteiger in die digitale Produktion parat? Was müssen diese bei der Softwareauswahl beachten?
Ich würde dazu raten, lieber direkt von Beginn an auf hochwertige und offene Systeme wie Freeform zu setzen. Am Anfang erscheint der Einstieg im Vergleich zu scheinbar „fertigen Systemen“ vielleicht schwerer, mit zunehmender Einarbeitung zahlt sich der gegebenenfalls höhere Zeitaufwand im Vorfeld allerdings aus.
Welche weiteren technischen Voraussetzungen benötigen die Betriebe?
Ein leistungsstarker 3D-Scanner, die für das Versorgungsfeld passenden Scanwerkzeuge sowie eine Software für das Modellieren und Konstruieren sollten von Beginn an angeschafft werden. Es bietet sich außerdem an, einen 3D-Drucker zu kaufen, der zumindest den Druck von Testorthesen ermöglicht. Das können kleine bis mittelgroße FDM-Drucker (FDM steht für Fused Deposition Modeling. Bei diesem Verfahren wird ein thermoplastisches Filament schichtweise aufgetragen. Anm. d. Red.) sein, die in der Lage sind, gängige und thermoplastisch nachformbare Materialen wie PLA, PP oder PETG zu verarbeiten. Da es sich hier zweifelsohne um eine Investition in die produktionstechnischen Fähigkeiten des Unternehmens handelt, sollten diese Werkzeuge nicht als nettes Spielzeug betrachtet werden, sondern als nötige Infrastruktur.
Was halten Sie von einem Tandem aus CAD-affinen Ingenieuren und Technikern bei der Erstellung der digitalen Dateien?
Das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut. Bei Häussler Technische Orthopädie GmbH arbeiten wir seit Jahren arbeitsteilig. Das heißt, unsere Orthopädietechniker übernehmen den Patientenkontakt sowie die Hilfsmittelplanung, während unsere digitale Produktion für die Herstellung zuständig ist. In diesem Rahmen beschäftigen wir unter anderem einen Fertigungsingenieur ohne spezifisches Fachwissen in der OT.
Wie beurteilen Sie die derzeitigen Ausbildungsinhalte zum Thema Additive Fertigung im Bereich der Orthopädie-Technik?
Leider bisher sehr unzureichend. Die digitale Fertigung bringt derart viele Vorteile und neue Möglichkeiten mit sich, dass sie in vielen Bereichen die konventionelle Produktion ablösen wird. Erfreulicherweise haben das eigentlich alle Bildungseinrichtungen unserer Branche erkannt und treffen bereits erste konkrete Maßnahmen. Wir unterstützen über die Akademie unserer Marke „TOplus“ diese Entwicklung sehr gerne über Gastvorträge oder externe Lehrtätigkeiten an Hochschulen und Fachschulen.
Wie kann man da eine Verbesserung erzielen, oder muss man vielleicht sogar einen neuen Beruf schaffen, um den Anforderungen aus handwerklicher und digitaler Technik gerecht zu werden?
Ich denke, dass hier im Moment viel unternommen wird und sich die Ausbildungslandschaft auch tatsächlich in die richtige Richtung entwickelt. Digitale Inhalte werden nach und nach fester Bestandteil der Bildungspläne. Der Umfang der Lehrinhalte im Bereich digitale Produktion sollte allerdings noch massiv steigen, um nötige Fähigkeiten auch wirklich in der Lehre und Ausbildung entwickeln zu können.
Es gibt auch bereits tolle Studiengänge in unserem Fachbereich, zum Beispiel an der Bundesfachschule für Orthopädie-Technik in Dortmund, in Göttingen oder auch in Münster, die einen akademischeren Ansatz unseres Berufsbildes verfolgen. Ich persönlich halte nach wie vor sehr viel von der klassischen Ausbildung zum Orthopädietechniker, aber bitte zukünftig mit umfangreichen Inhalten aus dem Bereich der digitalen Produktion. Das 3D-Scannen oder auch das rudimentäre digitale Modellieren sollte in jedem Falle beherrscht werden. Die Kombination aus Berufsausbildung und Studium ist eine weitere Möglichkeit, sich sowohl ingenieurstechnisch ausbilden zu lassen als auch die Grundfertigkeiten und Inhalte unseres Berufsbildes zu erlernen. An der Technischen Hochschule Ulm (THU) wurde bereits ein entsprechendes Pilotprojekt gestartet, das zukünftig verbessert und ausgebaut werden wird.

Um noch einmal einen Schritt zurückzugehen: Basis für die Modellierung und Konstruktion ist meistens ein Scan. Können Sie beschreiben, wie wichtig das Scanergebnis für die Modellierung ist?
Das Scanergebnis ist ausschlaggebend für die Güte des Modells. Lücken im Scan, Artefakte oder falsch vernetzte Scanfragmente führen zu unberechenbaren Fehlern im Gesamtprozess und sollten daher unbedingt vermieden werden. Der Schlüssel zum Erfolg sind hochwertige 3D-Scanner und gegebenenfalls Scanwerkzeuge für die Patientenpositionierung.
Was sind typische Fehler beim Scannen und wie lassen sie sich vermeiden, um Folgefehler in der Versorgung auszuschließen?
Uns fällt auf, dass oft zu schnell gearbeitet wird. Man sollte sich bei der Patientenpositionierung und beim 3D-Scannen unbedingt die nötige Zeit nehmen, bis der Datensatz auch wirklich sauber und vor allem geschlossen im PC erscheint. Ein gewissenhaftes Arbeiten an dieser Stelle spart unter Umständen viel Zeit bei den darauffolgenden Herstellungsprozessen.
Darüber hinaus ist es ratsam, wenn Anzeichnungen direkt auf dem zu scannenden Objekt oder dem Körperteil vorgenommen werden und mit einem 3D-Scanner gearbeitet wird, der diese dann auch aufnehmen kann. Wird ohne Anzeichnungen gearbeitet, steigt das Fehlerpotenzial, vor allem bei arbeitsteiliger Arbeitsweise. Natürlich müssen auch die grundlegenden Bedingungen beachtet werden: keine direkten Lichtquellen, Schmuck oder reflektierende Gegenstände ablegen und Haare unter Umständen plattdrücken.
Welches sind für Sie die größten Hürden für Neueinsteiger beim Modellieren und Konstruieren?
Bei Neueinsteigern ohne Vorerfahrung sehe ich gar keine Hürden. Die digitalen Fertigkeiten werden erlernt, als Standard verinnerlicht und angewendet. Techniker mit Erfahrung im Hilfsmittelbau stehen zu Beginn natürlich immer vor der Hürde, eine Tätigkeit altbewährt konventionell auszuführen oder mit Mehraufwand – zumindest zu Beginn – auf einem neuen, digitalen Weg. Das ist im Alltagsgeschäft durchaus eine Herausforderung, der man nur durch das konsequente Einräumen der nötigen Einarbeitungszeit in die neuen Verfahren begegnen kann.
Gibt es einen Versorgungsbereich, der sich besonders gut für den Einstieg eignet?
Ich würde sagen, dass sich der Bereich Orthetik, egal ob für die obere oder die untere Extremität, sehr gut für den Einstieg eignet.
Wie können interessierte Techniker ihren Vorgesetzten bzw. Betriebsinhabern den Einstieg in die digitale Produktion „schmackhaft“ machen?
Konsequent angewendet spart eine digitale Produktion teils massiv Zeit, begünstigt eine gleichbleibende Qualität, trägt zur Fehlervermeidung im Produktionsprozess bei, schafft gänzlich neue Möglichkeiten bei der Hilfsmittelgestaltung und hat dadurch das Potenzial, die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Darüber hinaus wird Kompetenz im Umgang mit neuen Technologien im eigenen Haus aufgebaut, wodurch auch langfristig unabhängig und mit hoher Wertschöpfung produziert werden kann.
Wo können sich die Techniker informieren über neueste Trends und Entwicklungen? Gibt es Messen, Veranstaltungen und Webinare, die Sie empfehlen können?
Natürlich ist das Thema digitale Produktion auf jeder Messe allgegenwärtig. Es ist allerdings nicht leicht, bei der Fülle an Möglichkeiten einen passenden Weg für das eigene Unternehmen zu finden. Hier setzen wir mit unserer TOplus Akademie an und bieten mit unserem kostenlosen Know-how-Wiki eine umfangreiche Informationsgrundlage. Sofern die Inhalte auch praktisch gefestigt werden sollen, zeigen wir in unseren Seminaren im Detail, wie eine digitale Hilfsmittelproduktion ablaufen kann. Außerdem kann sich jeder sehr gerne mit spezifischen Herausforderungen an uns wenden und wir erarbeiten über unser Consultingprogramm zusammen eine maßgeschneiderte und garantiert anwendbare Lösung.
Wie hoch schätzen Sie, wird der Anteil an Versorgungen unter Zuhilfenahme des 3D-Drucks in fünf Jahren in der Orthopädie-Technik sein?
Das wird sehr stark von der jeweiligen Struktur und Firmenstrategie abhängen. Bei Häussler Technische Orthopädie GmbH schätze ich den auf circa 70 Prozent.
Welche Trends bzw. Entwicklungen beim Scannen, Modellieren und 3D-Druck finden Sie interessant und was davon könnte in den kommenden Jahren Einzug in die Orthopädie-Technik halten?
Natürlich werden 3D-Scanner und 3D-Drucker immer leistungsstärker und zudem günstiger. Die bereits zur Verfügung stehenden digitalen Werkzeuge sind allerdings schon jetzt sehr gut anwendbar, daher rechne ich nicht mit tiefgreifenden Neuerungen in naher Zukunft.
Für uns sind standardisierte Vorgehensweisen der Schlüssel zum Erfolg. Wir werden den Fokus auf umfangreiche und sehr detaillierte Prozessdefinitionen legen. Der Trend geht also hin zu einwandfrei beschriebenen und im besten Falle teilautomatisierten Herstellungsprozessen im individuellen Hilfsmittelbau.
Die Fragen stellte Heiko Cordes.

Steffen Matyssek begann seine berufliche Ausbildung mit einer Lehre zum Orthopädietechniker. Anschließend absolvierte er ein Bachelor-Studium in Gießen, gefolgt von dem Masterstudiengang in Erlangen, bei dem er sich inhaltlich weiter mit Lösungen für und aus der Orthopädie-Technik beschäftigte. Seit 2016 ist er bei Häussler Technische Orthopädie GmbH der Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung und ist verantwortlich für die Digitale Produktion.
Hier finden Sie alle 6 Artikel unserer Serie „Additive Fertigung – Teil 2: Konstruieren“:
- Wie digitales Konstruieren die Orthopädie-Technik verändert
- Formvollendet: Software im Überblick
- Atemfreiraum geben – Praxisbeispiel zur Implementierung digitaler Workflows in der Korsettversorgung
- „Easy“ Einlagenkonstruktion – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Höchste Präzision gefordert – Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Gut modelliert wird doppelt belohnt
Für alle, die Teil 1 der Serie „Additive Fertigung“ noch nicht kennen:
Hier finden Sie alle 6 Artikel unserer Serie „Additive Fertigung – Teil 1: Scannen“:
- Der Weg in die Additive Fertigung
- 3D-Scanner im Überblick
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Einlagenversorgung
- Praxisbeispiel zur additiv gefertigten Sitzschalenversorgung
- Per Korrekturgestell zum individuellen Korsett
- Mit Punktwolke zur Präzision
- OTWorld macht Orthopädie-Schuhtechnik erlebbar — 13. Februar 2026
- Bufa-Meisterkurs sichert sich Basiszertifizierung — 12. Februar 2026
- Ein Ort des interdisziplinären Austauschs — 10. Februar 2026